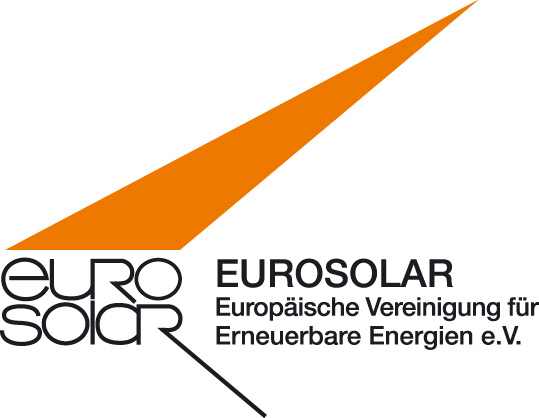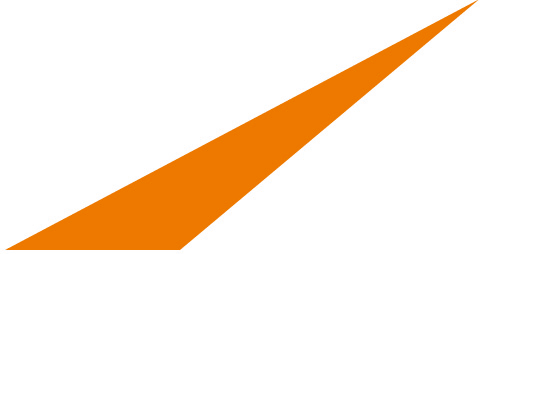In vielen Städten gibt es die Diskussion, in welchem Umfang die Fernwärmeversorgung ausgebaut werden soll. Aus den „goldenen“ Zeiten der Erdgasversorgung halten sich noch viele Vorurteile gegen die Fernwärme hinsichtlich hoher Kosten. Da die Erdgasversorgung perspektivisch ihrem Ende zugeht, ist die Fernwärmeversorgung jetzt mit der einzigen Alternative zu vergleichen, die in großem Stil Öl und Gas im Heizungsbereich ersetzen kann, der Wärmepumpe.
Die etwa 11.000 Kommunen in Deutschland müssen gemäß Wärmeplanungsgesetz bis zum 30.06.2028 eine Wärmeplanung vorlegen, Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern sogar noch zwei Jahre früher. Das Ziel, bis 2045 eine Klimaneutralität zu erreichen, führt dazu, dass die derzeit vorherrschende Beheizung mit Erdgas im wesentlichen durch klimaneutrale Fernwärmeversorgung oder durch Wärmepumpen ersetzt werden muss. Wasserstoff als Direktheizung scheidet nach dem Urteil der meisten Fachleute aus. Andere klimaneutrale Heizenergien werden rein mengenmäßig nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Für Kommunen und ihre Stadtwerke stellt sich die Frage, welche Aufteilung zwischen der Fern- bzw. Nahwärmeversorgung einerseits und dem Einsatz dezentraler Wärmepumpen andererseits angestrebt werden soll. Es spielt dabei eine wesentliche Rolle, wie sich die Kosten der Gesamtsysteme zueinander verhalten. Dies muss natürlich für jeden Einzelfall ermittelt werden, da unterschiedlichste Randbedingungen vorliegen. Hier soll versucht werden, anhand eines Beispiels eine Entscheidungshilfe zu geben. Die gewählten Parameter sind nur eine Momentaufnahme und sehen in jeder Stadt anders aus.
Modellfall
Als Beispiel soll eine Kommune von 100.000 Einwohnern herangezogen werden, die folgende Rahmenbedingungen aufweist:
- Zentrales Fernwärmenetz schon vorhanden, allerdings beschränkt auf die Innenstadt mit Gebieten von Häusern ab drei Stockwerken und einige große Wärmeverbaucher wie Verwaltungsgebäude, Schulen, Bäder u.a..
- Fernwärmeabgabe 250 Mio. kWh/a
- Erdgasabgabe Heizung und Gewerbe 1.500 Mio. kWh/a
- Stromabgabe 500 Mio. kWh/a
Im vorhandenen Fernwärmegebiet ist in der Regel eine größtmögliche Verdichtung vorzunehmen. Ausnahmen bilden Gebiete mit sehr niedriger Wärmedichte, die nur von einer Fernwärmeleitung durchzogen sind. Betrachtet für den Vergleich wird ein Quartier ohne Fernwärmeversorgung, das aufgrund einer höheren Wärmedichte ggf. „fernwärmewürdig“ ist.
Um die Frage der Fernwärmewürdigkeit zu untersuchen, wird für die Gegenüberstellung des Einsatzes von Fernwärme oder von Wärmepumpen eine Musterstraße von 1 km Länge herangezogen. Zur Hälfte ist diese Straße bestanden mit 80 Ein- bis Zweifamilienhäusern, die einen Anschlusswert von jeweils 12 kW aufweisen. Auf der anderen Hälfte stehen 40 Mehrfamilienhäuser, deren Anschlusswert je 50 kW beträgt. Die Anschlussleistung der 120 Häuser liegt damit bei 3000 kW. Bei einer Benutzungsdauer des Anschlusswertes von 1.700 h/a ergibt sich eine Wärmeliniendichte von 5.000.000 kWh/km. Bei derartigen Verhältnissen herrscht in Deutschland derzeit eine Erdgasversorgung vor. Hier ist jetzt eine Entscheidung zwischen dem Vorrang für ein Fernwärme- oder ein Wärmepumpengebiet zu treffen.
Investitionen
Um diese 3 MW Anschlussleistung zu erschließen, sind 1 km Fernwärmehauptleitung und 1km Fernwärmeanschlussleitungen zum Preis von insgesamt 2 Mio. € erforderlich. Die Investitionsanteile des vorgelagerten Wärmetransportnetzes sind demgegenüber deutlich geringer und werden von der genannten Investition mit abgedeckt.
Hinzu kommen die Investitionen für die Anlagen zur klimaneutralen Wärmeerzeugung. Hier werden auf lange Sicht vornehmlich Großwärmepumpen einzusetzen sein. Die Preise für diese Aggregate werden genau wie die Preise für dezentrale Wärmepumpen mit stark wachsender Stückzahl erheblich sinken. Die Nutzung von Wärme aus Abwasser und Flüssen wird hier die erste Wahl sein, ist aber in der Regel begrenzt. Daher wird dann vielfach auf die Nutzung von tiefer oder oberflächennaher Geothermie zurückgegriffen werden.
Bisher wurde die Fernwärme in Städten der vorliegenden Größenordnung vornehmlich mit Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen in Verbindung mit Öl- oder Gas-Spitzenkesseln erzeugt. Zur Spitzenabdeckung mit etwa 500 Stunden im Jahr können erdgasbefeuerte Anlagen auch nach 2045 auf Basis von grünem Wasserstoff oder daraus hergestellten Brennstoffen weiter betrieben werden. Ggf. müssen zu diesem Zweck auch neue möglichst preiswerte Gaskraftwerke wie z.B. Gasturbinen errichtet werden. Die Spitzenabdeckung ist zu ergänzen durch Anlagen auf der Basis von Biomasse wie z.B. Holzkesseln.
Um 3 MW Anschlussleistung zu versorgen, benötigt man 1,5 MW Fernwärmeerzeugerleistung. Als Addition der Anlagen für Grund- und Spitzenlast sowie der erforderlichen Großwärmespeicher wird hierfür eine Investition von 3 Mio. € geschätzt.
Im System dezentrale Wärmepumpen ist zunächst das Stromverteilungsnetz für die Versorgung der Anlagen hinsichtlich einer Verstärkung zu betrachten. Die Investitionsanteile für das vorgelagerte Transportnetz sind vergleichsweise gering und werden genau wie beim vorgelagerten Netz bei der Fernwärme in der Investition des Verteilnetzes mit berücksichtigt.
Das vorhandene Stromverteilnetz muss für die Ableitung der in Zukunft zu erwartenden PV-Anlagen auf und an Gebäuden ohnehin in vielen Fällen verstärkt werden. Diese Verstärkungen werden dann schon einen erheblichen Teil der zusätzlichen Bedarfsmengen für die Elektromobilität und die Wärmepumpen aufnehmen können. Sowohl die Ladevorgänge für Elektrofahrzeuge als auch teilweise der Einsatz von Wärmepumpen können intelligent gesteuert werden. Eine weitere Steuerungsmöglichkeit für den Stromabsatz wird dann vorliegen, wenn in vielleicht 10 Jahren eine größere Zahl intelligenter Zähler eingebaut ist. Daraus ergibt sich, dass nur ein Teil der für die Versorgung der Wärmepumpen notwendigen zusätzlichen Leistungen im Stromnetz Verstärkungen erfordern. Wegen der Vielzahl der hier einwirkenden Parameter erscheint eine Vorausbestimmung des Ausbauumfangs als Durchschnittswert kaum möglich. Es wird daher geschätzt, dass die Hälfte der Wärmepumpenleistung einen Netzausbau nach sich zieht. Ein Gleichzeitigkeitsfaktor spielt keine Rolle, da bei starken Minusgraden alle Heizungen voll in Betrieb sind.
Eine Wärmepumpenleistung von 3 MW erfordert bei mittleren Temperaturen eine Stromleistung von 0,9 MW. Bei niedrigen Temperaturen, wofür eine Heizung ausgelegt wird, geht der Wirkungsgrad bei Luft-Wärmepumpen, die überwiegend zum Einsatz kommen werden, von 3,5 auf geschätzt 2 zurück. Das ergibt eine Stromleistung von 1,5 MW. Wie oben erläutert ist damit ein zusätzlicher Netzausbau nur für die Wärmepumpen in Höhe von 0,75 MW nötig. 1 km Niederspannungsleitung wird mit einem Betrag von 600 T€ angesetzt. Es kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass eine Verstärkung der Hausanschlüsse nicht erforderlich ist. Die Verstärkung von Trafoleistung, ein eventueller Umbau vorhandener Trafostationen und der Neubau von Trafostationen in Einzelfällen wird noch einmal mit 100 T€ abgeschätzt. Insgesamt ist man damit bei 0,7 Mio. € für 3 MW Heizleistung.
Auf der Kundenseite fallen bei der Fernwärme die Hausstation sowie die hausinterne Fernwärmeanschlussleitung und beim Wärmepumpensystem die Wärmepumpe an. Um die Vergleichbarkeit herzustellen, wird angenommen, dass diese Investitionen jeweils vom Versorger über einen Dienstleistungs- bzw. Contractingvertrag übernommen werden. Förderungen werden nicht berücksichtigt, da schon auf mittlere Sicht die Förderpraxis unklar ist und außerdem derzeit sowohl die Fernwärme als auch die Wärmepumpen in unterschiedlicher Weise erheblich gefördert werden.
Die Fernwärmehausstation sowie die hausinterne Anschlussleitung werden mit 8 T€ angesetzt. Bei 120 Häusern sind dies rund 1 Mio. €.
Die Wärmepumpe wird komplett als Durchschnittswert der verschiedenen Haustypen mit 30 T€ angesetzt, wobei hierin ein Zuschlag für eine eventuelle Vergrößerung von Heizflächen enthalten ist. Heute liegen die Investitionen deutlich höher. Mit stark wachsenden Stückzahlen und einer damit einhergehenden Verbesserung der Technik werden die Preise stark fallen. Dieser Wert addiert sich für 120 Anlagen auf 3,6 Mio. €.
Für den Vergleichsfall ergeben sich für die Straße von 1 km Länge mit 3 MW Anschlussleistung folgende Investitionen:
Fernwärme:
Wärmenetz 2,0 Mio. €
Erzeugung: 3,0 Mio. €
Hausstationen: 1,0 Mio.€
____________________________________
Summe: 6,0 Mio. €
Wärmepumpe:
Stromnetz: 0,7 Mio. €
Wärmepumpen: 3,6 Mio. €
____________________________________
Summe: 4,3 Mio. €
Kosten
Kapitalkosten
Der Zinssatz wird in Anlehnung an den derzeitigen Wert mit 4% angenommen.
Fernwärmenetz und -hausstationen:
Nutzungsdauer 50 Jahre. Annuitätsfaktor 0,0466
Investition 3 Mio. €
Kapitalkosten 140 T€/a
Fernwärmeerzeugung:
Nutzungsdauer 40 Jahre Annuitätsfaktor 0,0505
Investition 3 Mio. €
Kapitalkosten 152 T€/a
Kapitalkosten Fernwärme gesamt 292 T€/a
Wärmepumpe Stromnetz:
Nutzungsdauer 50a Annuitätsfaktor 0,0466
Investition 0,7 Mio. €
Kapitalkosten 33 T€/a
Wärmepumpe Anlagen:
Nutzungsdauer 25 a Annuitätsfaktor 0,0674
Investition 3,6 Mio. €
Kapitalkosten 243 T€/a
Kapitalkosten Wärmepumpe gesamt 276 T€/a
Erzeugungskosten
Für die Musterstraße liegt der Wärmebedarf der Kunden bei
5.000.000 kWh/a.
Bei der Fernwärme kommen im Spitzenlastfall 5% der Wärme nicht von der Wärmepumpe, die eine Arbeitszahl von 5 aufweist. Es wird daher ein Zuschlag von etwa 25% auf die Erzeugungskosten angesetzt.
Fernwärme:
Fernwärmeverluste ca. 17 %
Erzeugungsmenge 6.000.000 kWh/a
Jahresarbeitszahl erdwärmebasierte Großwärmepumpe 5
Strombedarf Großwärmepumpe 1.200.000 kWh/a
Strombezugspreis im Mittelspannungsnetz 10 ct/kWh
Erzeugungskosten Großwärmepumpe 120.000 €/a
Zuschlag Erzeugungskosten Spitzenwärme 30.000 €/a
Fernwärme Erzeugungskosten gesamt 150.000 €/a
Wärmepumpe:
Jahresarbeitszahl Luft-Wasser-Wärmepumpe 3,5
Strombedarf Wärmepumpe 1.400.000 kWh/a
Stromverluste ca. 5%
Strombezugsbedarf 1.500.000 kWh/a
Strombezugspreis im Mittelspannungsnetz 10 ct/kWh
Erzeugungskosten Wärmepumpe 150.000 €/a
Betriebskosten
Fernwärme:
Dem Fernwärmebereich eines Energieversorgers, der 250 Mio. kWh/a abgibt, sind größenordnungsmäßig 30 Mitarbeiter°innen zuzuordnen, für die ein Aufwand von je 80.000 €/a geschätzt wird. Der Aufwand von 2,4 Mio. €/a wird auf den betrachteten Straßenabschnitt umgerechnet, für den 6 Mio. kWh/a benötigt werden. Es ergeben sich 58 T€/a.
Wärmepumpe:
Die 120 Wärmepumpen des betrachteten Straßenabschnitts würden bei einem Wartungs- und Betreuungsaufwand von je 4 Monteurstunden pro Jahr und Anlage einen Stundenbedarf von insgesamt 480 pro Jahr haben. Wird die Wärmepumpe privat betrieben, ist der Wartungsaufwand noch geringer, da der Hausbesitzer einzelne Überwachungs- und Reinigungsfunktionen selber übernimmt. Damit wäre ein Monteur zu 25% ausgelastet. Bei einem Aufwand pro Monteur von 80.000 €/a ergeben sich 20 T€/a. Die Mehrkosten im Strombereich des Energieversorgers werden vernachlässigt.
Gesamtkosten
Für die Gesamtkosten ergibt sich damit aus Sicht des Energieversorgers folgende Gegenüberstellung:
Fernwärme Wärmepumpe
___________________________________________________________________________________
Kapitalkosten 292 T€/a 276 T€/a
Erzeugungskosten 150 T€/a 150 T€/a
Betriebskosten 58 T€/a 20 T€/a
___________________________________________________________________________________
Gesamtkosten 500 T€/a 446 T€/a
Trotz der großen Spannweiten der Werte der verwendeten Parameter kann damit die Aussage getroffen werden, dass bei der laufenden Verbesserung der Wärmepumpen hinsichtlich Preis, Effektivität und Zuverlässigkeit eine Wärmepumpenlösung für den betrachteten Fall etwas günstiger ist. Der Modellfall kommt allerdings einer Kostenparität zwischen beiden Systemen sehr nahe.
Erträge
Fernwärme:
Bei einem kostendeckendem Ertrag für die verkaufte Wärmemenge von 5.000.000 kWh/a läge der Fernwärmepreis auf Basis dieser genannten Kosten bei 10 ct/kWh. Hinzu kämen noch verschiedene Verwaltungskosten, die Gewinnmarge sowie Steuern und Abgaben, was hier alles nicht quantifiziert werden soll. Die Fernwärmepreise für derartige Versorgungsfälle liegen in Deutschland häufig über 15 ct/kWh, womit ein Fernwärmeversorger in diesem Beispiel im wirtschaftlichen Bereich läge.
Bei höherer Wärmedichte würden die Kosten sinken, allerdings werden die Fernwärmepreise für Großkunden auch niedriger kalkuliert.
Wärmepumpe:
Übernimmt der Energieversorger Investition und Betrieb der Wärmepumpe in einem Contractingvertrag, würde er als Wärmelieferant im vorliegenden Fall zu etwa den gleichen Wärmepreisen kommen, da die Gesamtkosten sich nur geringfügig unterscheiden. In der Regel investiert und betreibt der Kunde jedoch die Wärmepumpe selber. Damit reduziert sich das Geschäftsmodell für das Stadtwerk bzw. das zuständige Energieversorgungsunternehmen auf den Stromnetzbetrieb und ggf. auf die Lieferung des Wärmepumpenstroms.
Der private Wärmepumpenbetreiber zahlt einen deutlich höheren Strompreis als hier angesetzt, da er u.a. die Abgaben und Steuern, die in ähnlicher Form bei der Fernwärme anfallen und die hier nicht betrachtet werden, über den Strompreis entrichtet. Betreibt er eine eigene Solaranlage, kann es für ihn deutlich günstiger werden.
Ausbaustrategie
In den stark verdichteten Kernen von Großstädten ist auch bisher schon die Fernwärme stark ausgebaut worden. Sie stand aber in Konkurrenz zur Erdgasversorgung, die bei geringeren Investitionen auf Basis des billigen Importgases zumindest kurzfristig wirtschaftlich attraktiver war. Erst auf längere Sicht erwies sich die Fernwärme auf Basis von Kraft-Wärme-Kopplung oft als die preiswertere und effektivere Lösung.
Nach Wegfall der Erdgasversorgung steht als Alternative zur Fernwärmeversorgung im wesentlichen nur noch die Wärmepumpe zur Verfügung. In stark verdichteten Gebieten sind jedoch Wärmepumpen aus räumlichen, optischen und akustischen Gründen schwieriger aufzustellen. Da bei hoher Wärmedichte die Fernwärme ohnehin Kostenvorteile hat, sollte das Erdgas dort nach Möglichkeit flächendeckend durch Fernwärme ersetzt werden. Diese Priorität wird dann noch verstärkt, wenn unvermeidbare Abwärme für die Einspeisung ins Fernwärmenetz genutzt werden kann.
Gerade in Kommunen mit bisher geringen Fernwärmeanteilen ergibt sich aber häufig die Problematik, dass die Kapazitäten für einen zügigen Fernwärmeausbau nicht vorhanden sind oder dass man nicht zu viele Baustellen haben möchte. Dies wird zur Folge haben, dass trotz Kostenvorteilen der Fernwärme in hochverdichteten Gebieten vielfach Wärmepumpen eingebaut werden.
Auf der anderen Seite geht die Wirtschaftlichkeit der Fernwärme bei niedriger Wärmedichte stark zurück. Dem bisweilen von politischer Seite vorgetragenen Wunsch, auch den „eigenen“ Ortsteil mit Fernwärme zu versorgen, sollte daher eine saubere Kostenanalyse entgegengestellt werden. Voraussetzung einer Versorgung mit Fernwärme bei grenzwertiger Wirtschaftlichkeit sollte sein, dass sich ein Großteil der Anlieger zu einem schnellen Anschluss an die Fernwärme bereiterklärt.
Fazit
Die vorstehende Betrachtung soll in erster Linie dazu dienen, die Wirtschaftlichkeit der Systeme Fernwärmeversorgung und Wärmepumpe in einzelnen Quartieren zu vergleichen, um Hilfestellungen für die Ermittlung der kostengünstigsten Variante zu geben. Ausdrücklich ist zu betonen, dass die vielen verwendeten Daten keine wissenschaftlich ermittelten Durchschnittswerte darstellen, sondern auf der Erfahrung des Autors sowie verschiedener befragter Fachleute beruhen. Die Rechnung muss für jeden speziellen Einzelfall überarbeitet werden.
Der hier betrachtete Modellfall stellt in etwa den Bereich dar, in dem die Kosten gleich sind. Steigt die Wärmedichte, so erhöhen sich die Vorteile für die Fernwärme. Im umgekehrten Falle schneidet die Wärmepumpe bei fallender Wärmedichte besser ab.
Dr. Dieter Attig war unter anderem lange Jahre Geschäftsführer der Stadtwerke Lemgo und Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Aachen.
Mit freundlicher Unterstützung von Uwe Weber und Dr. Georg Klene, beide Stadtwerke Lemgo