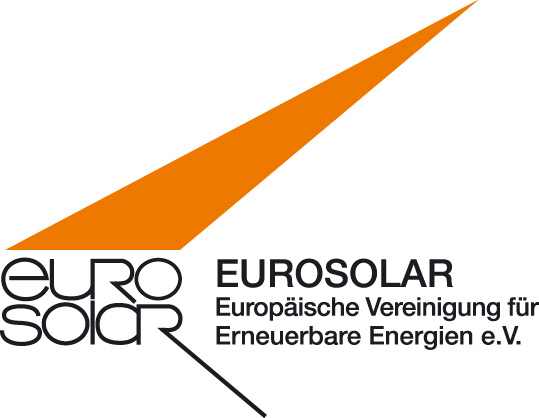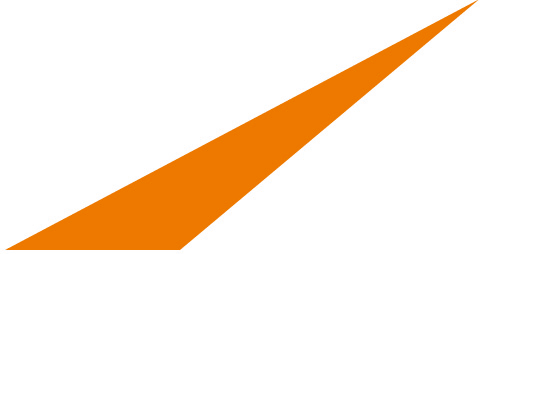SOLARZEITALTER 1-2025
Nach dem Ampel-Aus hat das SOLARZEITALTER mit Dr. Nina Scheer, MdB, über die Energiewende in der Post-Ampel-Ära gesprochen (SZA 2/2024, S.11). Sie hat betont: „Für die Energiewende ist es unabdingbar, dass wir weiterhin einen beschleunigten Ausbau Erneuerbarer Energien hinbekommen.“ Inzwischen ist eine neue Bundesregierung im Amt, getragen von CDU/CSU und SPD. Nina Scheer ist weiterhin Energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion und arbeitet im Deutschen Bundestag daran, dass die Energiewende mit der Umsetzung des schwarz-roten Koalitionsvertrags fortgeführt wird.
SOLARZEITALTER: Angesichts unterschiedlicher Signale aus dem Kabinett – von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Umweltminister Carsten Schneider (SPD) – fragen sich viele zur 100-Tage-Bilanz der Regierung: Bleibt die Energiewende auf Kurs Beschleunigung?
Nina Scheer: Das hängt nun ganz von der Ausgestaltung der anstehenden Vorhaben ab. Der Koalitionsvertrag lässt die Beschleunigung trotz einiger kritischer Aussagen – etwa solchen zu Gaskraftwerken und befristeten Engpasszonen – jedenfalls zu.
So sind eine Reihe Aussagen zum systemischen Umstieg auf Erneuerbare Energien drin – Anreize für Speicher, Flexibilitäten, eine deutliche Ausweitung des Instruments „Nutzen statt Abschalten“, aber etwa auch, dass wir alle Potenziale der Erneuerbaren Energien nutzen wollen. Die Aussagen zu den Netzen gebieten es, Ausbau und Transformation in Orientierung an den Erneuerbaren anzugehen. Teilweise wird dies andersherum unterstellt.
Fossile Subventionen
Zu Gaskraftwerken steht, dass „bis zu“ 20 GW ausgebaut werden sollen. „Bis zu“ heißt nicht „mindestens“, wie anfänglich mal von Katherina Reiche erklärt, sondern, dass sich jedes einzelne GW bedarfsseitig rechtfertigen muss. Hier gilt es darauf zu achten, dass sich keine Verschiebungen zugunsten der Fossilen durchsetzen. Dies gilt auch für Anschlussregelungen an EE-Förderung, mit Einführung des EU-seitig verlangten Claw Back Mechanismus.
Dass es schnell eine fossile Schlagseite bekommen kann, sieht man etwa bei den nun angelegten Energiepreisentlastungen. Der Koalitionsvertrag sieht eine sofortige Absenkung der Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß vor. Die Gasspeicherumlagenbefreiung ist ebenfalls eine Aussage des Koalitionsvertrages, allerdings nicht mit dieser Dringlichkeit hinterlegt. Wenn nun die Stromsteuersenkung nicht für alle kommt, hingegen sehr wohl bereits die Gasspeicherumlagenabsenkung, nutzt das den Fossilen gleich zweifach: durch die relative Begünstigung von Gas und durch den ausbleibenden Vergünstigungsanreiz für Wärmepumpen. Deswegen halte ich die fehlende Absenkung der Stromsteuer für einen Fehler. Er lässt sich auch nicht durch den Finanzierungsvorbehalt relativieren, denn schließlich werden nun Entlastungen vorgenommen, die laut Koalitionsvertrag in dieser Eile nicht kommen müssten. Es lässt sich im Übrigen auch nicht rechtfertigen, die Gasspeicherumlagenbefreiung aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) zu finanzieren.
Beschleunigte Planung und Genehmigung für Erneuerbare gerettet
SOLARZEITALTER: Ein erster Lackmustest für die neue Koalition war die vor der Sommerpause umgesetzte EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) in deutsches Recht. Die im Zuge der Energiekrise erlassene EU-Notfallverordnung hat ein hohes Ausbautempo für die heimische Wind- und Solarenergie sichergestellt, lief aber Mitte dieses Jahres aus. Die RED III hat mit den Beschleunigungsgebieten die Chance eröffnet, weiter ausreichend Flächen für Wind- und Solaranlagen bereitzustellen und Genehmigungsverfahren zügig durchzuführen. Irritierend war, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung keine Ausweisung neuer Beschleunigungsgebiete für Windenergie mehr ermöglichen wollte. Dies hätte dramatische Auswirkungen auf die Energiewende gehabt und konnte im parlamentarischen Verfahren gerade noch abgewendet werden. War das ein erster Vorgeschmack, auf das was uns in dieser Legislaturperiode erwartet? Wird nun jedes Gesetzgebungsverfahren zu einem Drahtseilakt für die Energieversorgung der Zukunft?
Nina Scheer: Während des Gesetzgebungsverfahrens wurde von Seiten der Union jedenfalls die eigentliche RED III-Gesetzgebung faktisch ausgeblendet; der alleinige Fokus wurde auf den angehängten Gesetzes-Artikel zur Beschränkung des Windenergieausbaus gelenkt – die Fortsetzung von „Lex Sauerland“. Hier konnten dann im Parlamentarischen Verfahren weitergehende Einschränkungen abgewendet werden.
Es kommt auch darauf an, was nun aus dem Ministerium vorgelegt wird und was nicht. Zum Beispiel fehlen im Gesetzentwurf für eine EnWG-Novelle dringend benötigte Stellschrauben für vereinfachte Netzanschlüsse und mehr Transparenz zur Netzauslastung. Stattdessen werden Gesetzesänderungen vorangebracht, die der fossilen Ressourcennutzung dienen. Zudem liegt das Solarpaket 2023 nach wie vor zur Notifizierung in Brüssel, auch die Erleichterungen zur Bioenergienutzung, die wir mit Grünen und CDU/CSU nach dem Ampelbruch Ende Januar beschlossen haben.
Wann dürfen Erneuerbare ihre ökonomischen Vorteile ausspielen?
SOLARZEITALTER: Im Herbst stehen bereits EEG und EnWG auf der Agenda? Schicksalsthemen der Energiewende stehen auf der Tagesordnung. Bis 2026/27 muss wegen des Anpassungsdrucks aus Brüssel die Frage beantwortet werden, wie das EEG der Zukunft aussieht. Und gleichzeitig wird es darum gehen, ob die Erneuerbaren in der Energiemarktordnung endlich als systemsetzend anerkannt werden oder im alten System aus fossil-atomaren Zeiten verharrt werden soll. Das Verharren führt inzwischen zu hohen Kosten. Man würde denken, dass in Zeiten wirtschaftlicher Verwerfungen – hohe Exportzölle zum US-Markt, Krise der deutschen Automobilindustrie – alles dafür getan wird, unnötige volkswirtschaftliche Kosten, wie beim Redispatch, zu vermeiden. Wie lange will sich Deutschland noch ein veraltetes, kostentreibendes Energiemarktdesign leisten? Wann endlich werden die Erneuerbaren von Seiten der Marktordnung so behandelt, dass sie ihre ökonomischen Vorteile zum volkswirtschaftlichen Nutzen ausspielen können?
Nina Scheer: Mit dem Wording des kostentreibenden Energiemarktdesigns bin ich zurückhaltend, da es zur Zeit von einigen Seiten verwendet wird, um die Energiewende abzuwickeln und einen „Neustart“ zu fordern. Dies habe ich ja auch in meinem Brief an Katherina Reiche zum Monitoringprozess kritisiert, der, nachdem er öffentlich wurde, nun auch auf meiner Homepage zu finden ist.
Mit ihrer Beauftragung eines Monitorings zum Stand der Energiewende verfolgt Katherina Reiche offenkundig das Ziel, künftig von deutlich weniger Strombedarf ausgehen zu können. Daraus wird dann gefolgert, man müsse nicht so schnell so viel Erneuerbare ausbauen. Die sogenannte Leistungsbeschreibung, mit der das Monitoring in Auftrag gegeben wurde, nennt etwa eine Reihe laut Auftrag zu berücksichtigender Studien, die sich teilweise übrigens gegenseitig aufeinander beziehen, und die eine solche Richtung intendieren – jenseits der koalitionären Verständigung.
Monitoringprozess gegen Logik der Energiewende
Auch dies habe ich in meinem Brief angemerkt. Der Wille eines sektorübergreifenden beschleunigten Umstiegs auf die Erneuerbaren ist daraus leider nicht zu erkennen – ganz im Gegenteil. Und eben deswegen muss nun verstärkt auf die Verfolgung all jener Maßnahmen gedrungen werden, die uns die systemische Energiewende gelingen lassen. Von Flexibilitäten bis hin zu einer „deutlichen Ausweitung“ des Instruments „Nutzen statt Abschalten“ – auch dies ist im Koalitionsvertrag verständigt und wurde mit den bislang vorliegenden Kabinettsbeschlüssen noch nicht aufgegriffen.
In Bezug auf die Neuaufstellung der EE-Förderung muss darauf geachtet werden, dass sie nicht zur Blockade der bereits beschlossenen Vorhaben führt und auch, dass wir hier nicht bei einer ökonomistischen Ausrichtung landen. Will heißen: Es darf nicht dazu kommen, dass Förderungen nur noch bei Premium-Standorten stattfinden, oder gar im Ausland. Einen Vorgeschmack hat uns hier die Diskussion zum EU-Emissionshandel (ETS) gegeben, wobei die Union gern die Anrechenbarkeit von CO2-Minderung auch bei Auslandsinvestitionen bekommen wollte. Diese wurde nun – in einem begrenzten Maß, leider ja auch europäisch verständigt. In die gleiche Richtung geht es, wenn Frau Reiche nun in Bezug auf die Solarenergieförderung erklärt, die Dachanlagen bräuchten keine Einspeisevergütung mehr. Auch hiermit orientiert sie sich an Premium-Standorten und verallgemeinert dies, womit uns wertvolle Flächen und Akteure sowie der Mehrwert des dezentralen Ausbaus verloren gehen.
Preisgünstigkeit und Energiesicherheit funktionieren nicht mit Erdgas
SOLARZEITALTER: In der einseitig auf große Gaskraftwerke fokussierten Kraftwerksstrategie von Wirtschaftsministerin Reiche („mindestens 20 GW“) schlummern weitere Kosten- und Energiesicherheitsrisiken. Schon vor dem russischen Angriffskrieg war Erdgas nicht mehr „billig“ und der Preis wird auch wegen der wachsenden Abhängigkeit von teurem US-Fracking-Erdgas in Zukunft eher steigen. Im Übrigen sind die Hersteller großer Gaskraftwerke auf dem Weltmarkt stark ausgelastet und können nicht rechtzeitig bis 2030 liefern. Wie will die Koalition unter diesen Vorzeichen für günstige Energiepreise und gesicherte Leistung für Energiesicherheit sorgen?
Nina Scheer: Eine große Herausforderung und energiewendeorientierte Aufgabe wird sein, die Aussagen zur Kosteneffizienz des Koalitionsvertrages und die Erkenntnis um die geopolitischen Gefahren, die in fortgesetzten Abhängigkeiten von fossilen Ressourcen liegen, auf den Umgang mit Erdgas zu fokussieren. Dem Agieren von Katherina Reiche ist zu entnehmen, dass sie unter Verweis auf „Technologieoffenheit“ erstmal keinen Unterschied zwischen CO2-Minderung durch Erneuerbare und CO2-Minderung durch Erdgas mit CCS machen möchte. Damit räumt sie offenbar unter Verweis auf die Anforderungen der Systemintegration der Erneuerbaren letztlich sogar den Fossilen den faktischen Vorrang ein. Wenn CDU/CSU allein regieren würden, stiegen sie möglicherweise auch erneut in Atomenergienutzung ein. Es lässt jedenfalls tief blicken, dass unsere Energieministerin vor einigen Wochen in Brüssel das Treffen der Nuklear-Allianz, bei dem sie nur einen Gast-Status hatte, dem zeitgleichen Treffen der europäischen Energieminister vorgezogen hat.
Erneuerbare müssen Vorrang haben
Insofern sehe ich unsere größte Aufgabe nun darin, die benötigten Weichen zugunsten der Erneuerbaren gestellt zu bekommen und an Gaskraftwerke energiewendeorientierte Anforderungen zu setzen: Erneuerbare müssen Vorrang haben – inklusive von Nutzen statt Abregeln, Speicheroptionen, Bioenergie, Flexibilitäten usw.; und dann noch benötigte neue Gaskraftwerke müssen wasserstofffähig sein. Der Vorrang der Erneuerbaren muss auch während der Nutzungsphase Vorrang bekommen. Diese Anforderungen sind kein Selbstläufer: sie stehen nicht als ausformulierte wörtliche Anforderungen an Gaskraftwerke im Koalitionsvertrag, sind aber gleichwohl enthalten, etwa in den Aussagen, dass wir alle Potenziale Erneuerbarer Energien nutzen wollen, dass sich Erneuerbare Energien perspektivisch am Markt refinanzieren können sollen, dass wir Nutzen statt Abregeln deutlich ausweiten wollen, dass wir Flexibilitäten und Speicher anreizen wollen. Dies alles ist – zumal kosteneffizient – nur erreichbar, wenn wir nun keine Konkurrenz durch Gaskraftwerke schaffen. Und bei der Kosteneffizienz dürfen die externen Effekte, die Folgelasten nicht unter den Tisch fallen.
Eine weitere Herausforderung wird nun der Umgang mit der im Zolldeal zwischen Donald Trump und Ursula von der Leyen eingegangenen Abnahmeverpflichtung fossiler und nuklearer Ressourcen und Technologien im Umfang von 750 Mrd. US-Dollar bzw. jährlich 250 Mrd. Wenn dies erfüllt würde, bedeutete dies gegenüber heute – selbst wenn die Preise ansteigen sollten, einen deutlichen Mehrverbrauch fossiler Ressourcen. Dazu darf es nicht kommen. Der Deal kollidiert dabei zudem mit EU-Recht. Denn über den Energiemix entscheiden laut Vertrag von Lissabon allein die Mitgliedstaaten. Wenn nun Mehrverbrauch verlangt wird, greift dies in diese Gesetzgebungshoheit ein. So kurios es klingen mag: Energiewende- und klimapolitisch halte ich es für geboten, die betreffenden Mengen auch dann nicht zu verbrauchen, wenn dafür gezahlt wird. Priorität sollte nun aber haben, nach möglichen Verbündeten zu suchen, um entsprechende Deals abzuwenden. Denn Donald Trump macht hier faktisch „Schutzgelderpressung“ mit der Absicht in die Politiken anderer Staaten hineinzuregieren. Dies gibt er inzwischen etwa in Bezug auf Brasilien unverhohlen zu: ihm gefiele der Umgang mit Bolsonaro nicht, deswegen sind es für Brasilien teilweise 50 % Zölle.
Ausbau beschleunigen und Kosten senken
SOLARZEITALTER: Einen schnellen Weg zu Netzentlastung und Marktwirtschaft der Erneuerbaren zeichnet der Koalitionsvertrag bereits vor: Die räumliche Ausweitung der physikalischen Direktversorgung der Industrie außerhalb der Netzregulierung. Die Ampel-Regierung hat hierzu einen ordentlichen Gesetzentwurf beschlossen, der nach dem Bruch der Koalition wegen fehlender Mehrheit nicht mehr vom Parlament verabschiedet werden konnte. Welche Pläne hat die neue Koalition?
Nina Scheer: Auch hier gilt: Es muss zur Umsetzung der energiewendeorientierten Aussagen im Koalitionsvertrag kommen. Die Begünstigungsfaktoren müssen eindeutig sein, damit wir den benötigten Beschleunigungseffekt bekommen.
SOLARZEITALTER: Die fluktuierenden Erneuerbaren Sonne und Wind dominieren inzwischen die Stromerzeugung und sollten deshalb in der Energiemarktordnung systemsetzend werden. Das würde die Kosten im Energiesystem drücken. Weitere Kostensenkungspotenziale bestehen bei den Erneuerbaren. Die Kunst besteht darin, solche Kostensenkungspotenziale zu adressieren, die nicht den beschleunigten Ausbau hemmen. Der Koalitionsvertrag will dafür das Referenzertragsmodell überprüfen und die zulässige Höhe der Flächenpachten für im EEG geförderte Anlagen begrenzen. Hiermit werden tatsächlich erhebliche Kostenfaktoren adressiert: Nicht gedacht war das Referenzertragsmodell dafür, in windhöffigen Regionen die gegenseitige Wind-Abschattung dichter Windpark-Layouts auszugleichen, sondern den notwendigen Ausbau in der Mitte und im Süden Deutschlands voranzubringen, um regional bedingte geringere Windgeschwindigkeiten auszugleichen. Wie wird sichergestellt, dass der notwendige Ausbau in der Mitte und im Süden Deutschlands weiterhin stattfinden kann?
Nina Scheer: … Aus eben diesem Grund ist die Abschattensregelung in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden. Je nach Anwendung kann sich die Aussage zu den befristeten Engpassgebieten kritisch auswirken. Diese kam zuletzt noch hinein und beinhaltet das Unionsanliegen, wie wir es jetzt auch bei der Solar-
energiekürzung erkennen können und wie es unionsseitig auch teilweise öffentlich erklärt wird: Erneuerbare sollen nach Unionssicht nur noch gebaut werden, wo es das Netz zulässt. Der Koalitionsvertrag erklärt allerdings zu dieser Frage, dass die Netze mit den Erneuerbaren synchronisiert werden sollen – und nicht umgekehrt.
Zurück zur Windenergie: Auch bei dieser, auf Windenergie bezogenen Aussage, sind Bedingungen enthalten: Die Ziele der Windenergie dürfen nicht beeinträchtigt werden und es gibt einen Prüfauftrag. Dennoch ist hier Vorsicht geboten. Das Referenzertragsmodell darf im Kern nicht in Frage gestellt werden.
SOLARZEITALTER: Der zweite erhebliche Kosten- und sogar Ausbauverhinderungsfaktor ist das Marktversagen bei Flächenausbietungsverfahren insbesondere auf staatlichen Forstflächen. Gerade in den Bundesländern im Mittelgebirge befindet sich ein Großteil der ausgewiesenen Windenergiegebiete im Eigentum von Forstbetrieben der Länder. In den Ausbietungsverfahren setzt sich in der Regel der Meistbietende durch. Projektierer haben nur dann eine Chance, wenn sie „Wucher-Pachtentgelte“ bieten. Oft erweisen sich die Gebote als unwirtschaftlich und werden zurückgegeben. Die Konsequenz ist fatal: Windenergie kann unter diesen Randbedingungen entweder keine günstigen Strompreise bieten, z.B. bei der Direktversorgung der Industrie, oder wird erst gar nicht ausgebaut. Wie will die Koalition dem Marktversagen bei den Flächenpachten begegnen?
Erfolgreiches EEG
Nina Scheer: Eben hierauf wollen wir mit einer Eingrenzung bei den Pachtzinsen reagieren, wobei im Koalitionsvertrag an die Förderfähigkeit angeknüpft wird. Die genaue Ausgestaltung ist noch offen. Dies gilt auch für die Fördersystematik im Generellen. Wir sollten uns immer daran erinnern, wie erfolgreich das EEG bis heute wirkt. Entscheidend wird sein, dass dem gemeinsamen Willen, alle Potenziale der Erneuerbaren Energien nutzen zu wollen, auch hierbei Rechnung getragen wird.
Das Interview führte Fabio Longo.